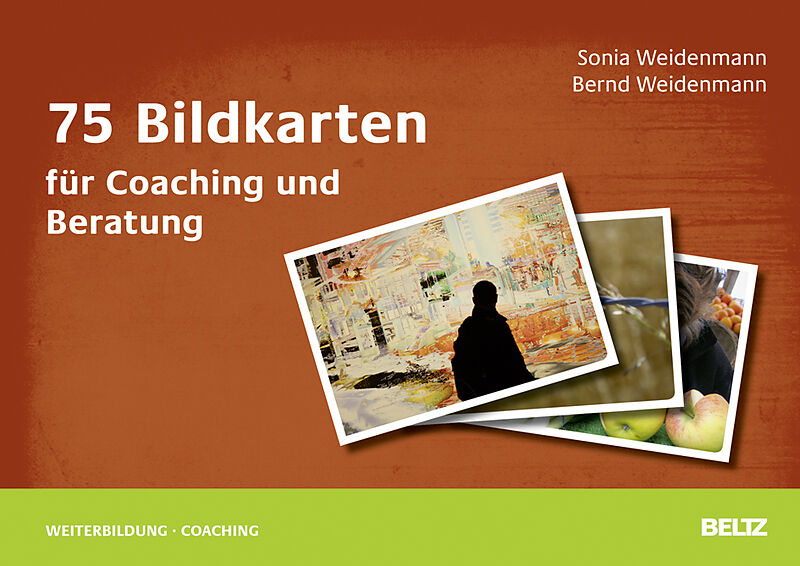Laut Diagnostik zeigen alle meine SchülerInnen eine starke Entwicklungsverzögerung auf. So stehen auch meine neunjährigen 3.Klässler auf dem Entwicklungsstand von einem Kleinkind.
Doch was meinen wir überhaupt mit dem Begriff Entwicklung? Was zeichnet Entwicklung aus und was bedeutet es für meine Förderplanung, wenn ein Kind eine Entwicklungsverzögerung hat?
Zu den Fragen, was Entwicklung bedeutet, wie sie abläuft und was sie vorantreibt, gibt es unterschiedliche Theorien. Im Folgenden gehe ich auf drei wesentliche Theorien genauer ein:
Interaktionistische Theorie von Lew S. Wygotski (1896-1934)
Nach seiner Theorie, entwicklet das Kind nahezu alle psychischen Strukturen und kognitiven Fähigkeiten durch die Interaktion mit anderen Menschen. Durch Anleitung und Interaktion gelangt ein Kind von seiner aktuellen Zone der Entwicklung in die Zone der nächsten Entwicklung. Was über der ZdnE ist, überfordert das Kind. Wygotski spricht insbesondere der Sprache und dem Spiel grosse Bedeutung zu.
Autogenistische Theorie von Jean Piaget (1896-1980)
Nach Piagets Stufenmodell durchlebt jedes Kind verschiedene aufeinander aufbauende Stufen. Um die nächste Stufe zu erreichen, muss erst die Vorherige durchlebt werden. Die Prozesse der Assimilation (Vertrautes erkennen durch bereits bestehende Schemata) und Akkomodation (Transformation der Schemata durch neue Erkenntnisse) zeichnen den Entwicklungverlauf nach Piaget aus.
Exogenistische Theorie von B.F. Skier (1904-1990)
Skinner geht davon aus, dass Konsequenzen, die auf ein Verhalten folgen, eben dieses Verhalten beeinflusst. Verhaltensweisen, auf die das Kind angenehme Konsequenzen erlebt oder unangenehme Konsequenzen vermeiden kann, werden vermehrt gezeigt. Skinner unterscheidet dabei positive und negative Verstärkungen.
Bei der Förderung und Erziehung von Regelschulkindern bedienen wir uns gerne verschiedener Theorien. Je nach Situation wird die eine Theorie oder die Andere beigezogen. - oft ganz unbewusst und intuitiv.
Alle drei Theorien haben sowohl positive Aspekte, als auch negative oder überholte Sichtweisen. Darauf möchte ich aber nun nicht genauer eingehen. Vielmehr stellt sich mir die Frage, inwiefern die Theorien für meinen Schulalltag mit schwer mehrfachbehinderter Kinder relevant sind.
In Wygotskis Theorie der ZdnE finde ich mich in meiner Rolle als Lehrperson wieder. Auch der grossen Bedeutung der Sprache, wobei ich konkretisieren möchte: der Kommunikation, kann ich beistimmen. Ich bin der Überzeugung, dass Interaktionsprozesse für Entwicklungsschritte unabdingbar sind. Dennoch beobachte ich bei meinen Schülern auch einen gewissen stufenförmiger Entwicklungsverlauf und bediene mich teilweise bewusst dem Modell nach Piaget. So kann ich bei manchen Schülern eine stufenförmige Entwicklung, wie sie Piaget beschrieben hat, erkennen. Als Beispiel die kognitive Entwicklung innerhalb der Sensomotorik nach Piaget. Nur stellt sich mir dort die Frage; was wenn die kognitive Entwicklung auf Grund einer Körperbehinderung nicht mit der motorischen Entwicklung übereinstimmt. Wie kann ich dann die kognitiven Leistungen einschätzen ohne den Schüler per se zu unterschätzen?
Und so bleibt noch Skinner, der in der Erziehung seinen festen Platz findet. Lob und Tadel repräsentieren weitestgehend die Erziehung im Elternhaus und in der Schule. Dem ist an sich auch nichts auzusetzten, wenn man es achtsam einsetzt und immer wieder überprüft, in welchen Situationen es sinnvoll ist und wo Entwicklungsschritte durch die Konsequenzen gehemmt werden.